|
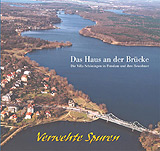 An einem hochsommerlichen Tag im Juli 1991 regnete es in Berlin-Mitte in
Strömen, aber nur wenige Kilometer südwestlich war der Himmel klar.
Dieses Stückchen Blau über einem kleinen Teil des ins Umland
auslaufenden Berlins war ein Glückszeichen für die drei Dutzend
Menschen, die sich zu einer kleinen Feier auf dem eleganten Gelände des
Glienicker Schlosses mit seinen zum östlichen Ufer der Havel hin
abfallenden Rasen- und Gartenanlagen versammelt hatten. Die Gäste
schlenderten auf dem Rasen, nippten am Champagner und kosteten von den Tellern,
auf denen sich Salate, Fleisch und Käse häuften. Sie gehörten
zu der privilegierten Schicht Berlins - Professoren, Landschaftsarchitekten,
Stadtplaner, Architekturhistoriker und Denkmalpfleger. Der Zweck des
Zusammentreffens war, ein jüngst wiederentdecktes Gebäude in dem
erlesenen Kranz von Schlössern und Herrenhäusern entlang der Havel
willkommen zu heißen: eine schlichte, aber elegante Villa im
italienischen Stil jenseits des Flusses, mitten im Blickfeld des Ortes, wo sie
standen.
An einem hochsommerlichen Tag im Juli 1991 regnete es in Berlin-Mitte in
Strömen, aber nur wenige Kilometer südwestlich war der Himmel klar.
Dieses Stückchen Blau über einem kleinen Teil des ins Umland
auslaufenden Berlins war ein Glückszeichen für die drei Dutzend
Menschen, die sich zu einer kleinen Feier auf dem eleganten Gelände des
Glienicker Schlosses mit seinen zum östlichen Ufer der Havel hin
abfallenden Rasen- und Gartenanlagen versammelt hatten. Die Gäste
schlenderten auf dem Rasen, nippten am Champagner und kosteten von den Tellern,
auf denen sich Salate, Fleisch und Käse häuften. Sie gehörten
zu der privilegierten Schicht Berlins - Professoren, Landschaftsarchitekten,
Stadtplaner, Architekturhistoriker und Denkmalpfleger. Der Zweck des
Zusammentreffens war, ein jüngst wiederentdecktes Gebäude in dem
erlesenen Kranz von Schlössern und Herrenhäusern entlang der Havel
willkommen zu heißen: eine schlichte, aber elegante Villa im
italienischen Stil jenseits des Flusses, mitten im Blickfeld des Ortes, wo sie
standen.
Im besonderen waren sie gekommen, um auf den Studenten Dirk Heydemann
anzustoßen, der vor kurzem durch seine Forschungen nachgewiesen hatte,
daß der Garten hinter jener Villa die Schöpfung eines der
berühmtesten preußischen Landschaftsarchitekten war - ein in den
vierzig Jahren des Kommunismus verschütteter Schatz. Sie lauschten der
Ansprache des Mentors, dann der des Studenten selbst. Man reichte Kopien seiner
Arbeit herum, eine prächtig gebundene und illustrierte Geschichte des
Hauses und seines Gartens nahe der berühmten Glienicker Brücke. Sie
erfuhren von dem preußischen Hofmarschall von Schöning, der einst in
diesem Hause lebte und von der jüdischen Bankiersfamilie, den Wallichs,
die nach ihm kamen. Jetzt forderte die Familie Wallich die Villa am
gegenüberliegenden Ufer zurück.
An diesem Nachmittag hatte die versammelte Gesellschaft eine leicht
verklärte Sicht auf diesen Teil der Berliner Havellandschaft. Wenn man ein
wenig die Augen zusammenkneift, fühlt man sich weit zurückversetzt in
die Tage der Hohenzollernherrschaft, als die stattlichen Häuser der
Prinzen und die weiten, sich wellenförmig erstreckenden Gärten aus
einem Guß waren, als Residenzen aus importierten Materialien gebaut und
mit zurückhaltender Kultiviertheit ausgestattet wurden - eine italienische
Marmorstatue hier, ein bißchen venezianisch-byzantinische Kunst dort. Man
blinzle noch ein wenig mehr und jenseits des Wassers steht eine Villa des 19.
Jahrhunderts, ein kleines glitzerndes Juwel des eleganten Potsdam, ein Heim
preußischen Adels.
Dies war die Wirkung eines romantischen Abstands von knapp zweihundert Metern.
Hätten sie ihre Feier am gegenüberliegenden Ufer abgehalten -
unmittelbar an der Villa -, hätten sie ein völlig anderes Bild
gesehen. Sie hätten die Narben, die die jüngste Geschichte am Haus
hinterlassen hatte, und die Vernachlässigung der vergangenen fünfzig
Jahre gesehen. Sie hätten gesehen, daß der Putz abbröckelt und
die darunterliegenden roten Ziegel freilegt, daß der Garten in keinerlei
Hinsicht mehr königlich war. Ja, es gab noch die großartigen 150
Jahre alten Bäume, aber nur wenige hatten überlebt. Und eine ziemlich
armselige Ansammlung von verrosteten Spielplatzgeräten stand jetzt im
Garten hinter dem Haus. Vor dem Haus hätten sie ein überwuchertes,
schlammiges Ufer angetroffen - die Damen in ihren Pumps und die Herren in ihren
blanken schmucken Schuhen - mühsam über große Betonbrocken
kletternd. Die ähnelten Autobahntrennelementen, waren aber
tatsächlich Reste der Berliner Mauer, die einst die beiden Ufer trennte.
Nun lagen sie zertrümmert nahe dem Wasser zu Füßen der
Glienicker Brücke, die wiederum selbst - wie die Mauerstücke auch -
eine Inkarnation des Kalten Krieges war.
Aber all das sahen sie nicht. Sie blieben sicher auf der anderen Seite des
Flusses und sahen, was sie sehen wollten. Auf der Party bemerkten sie
vielleicht doch zwei Frauen, die am Rand der Festlichkeiten standen, die eine
war jung, dunkelhaarig und auffallend, die andere im mittleren Alter, mit
Falten in ihrem verhärmten Gesicht. Vielleicht erkannten sie, daß
diese zwei Frauen nicht ganz ins Bild paßten. Sie waren anders angezogen
in ihrer einfachen, von keinem Maßschneider stammenden Bekleidung. Und
sie verhielten sich anders. In ihren Händen hielten sie keine
Champagnergläser und keine kleinen Dessertteller voller Delikatessen.
Der Student, ein lächelnder junger Mann, dessen blasser Teint durch seine
geröteten Wangen hervortrat, hatte diese Frauen nur beiläufig in
seiner Ansprache erwähnt. Er dankte ihnen dafür, daß sie ihm
während der Monate seiner Forschung Zutritt zum Garten gewährt
hatten. Aber er nannte sie nicht beim Namen. Statt dessen waren sie die
"Erzieherinnen am Kinderwochenheim". Kaum jemand beachtete seinen
Dank. Aus dem, was er sagte, nahmen sie an, daß während der vierzig
kommunistischen Jahre in Ostdeutschland, dessen Grenze genau in der Mitte der
Havel verlief, die Villa irgend eine Art Einrichtung der Jugendfürsorge
gewesen war. Vielleicht war sie es noch. Aber sie nahmen auch an, daß
dieses Kapitel im Leben des Hauses - sicher ein Fehler - bald in der Geschichte
verschwinden würde.
Dirk Heydemann empfahl der Stadt Potsdam, dieses Haus in ein
Dokumentationszentrum umzuwandeln. Die Bilder und Pläne in seiner Arbeit
veranschaulichten, wie makellos Haus und Garten im Preußen des 19.
Jahrhunderts gewirkt hatten und wie sie nach der Renovierung wiederum aussehen
könnten. Es wäre seine große Hoffnung, so sagte er den
Zuhörern, wenn die Nachkommen Hermann Wallichs helfen würden, das
Haus wieder so herzurichten, wie es einmal ausgesehen hatte, und ihn in seinem
Bemühen unterstützten, der Villa ihren früheren Glanz
zurückzugeben.
|

